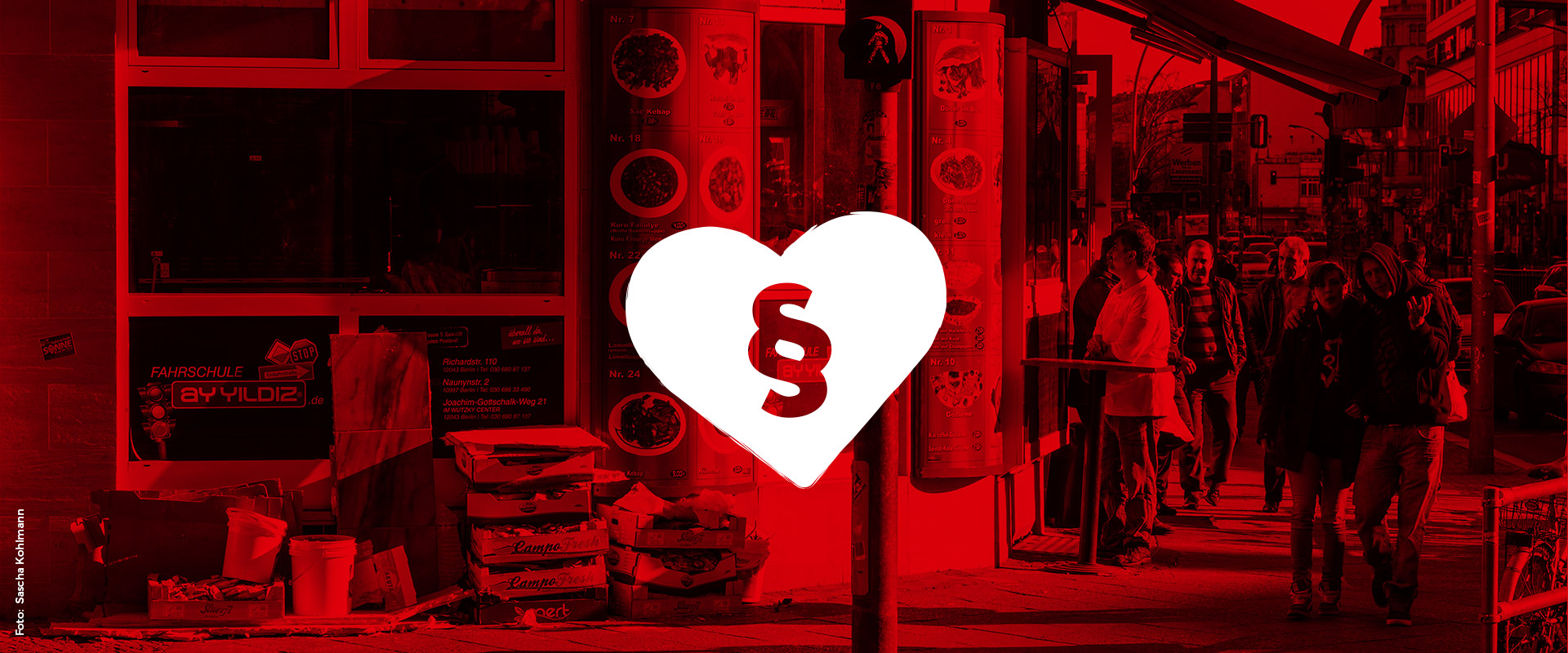Wir sind im Alltag mit ziemlichen vielen und ziemlich komplexen Problemen konfrontiert. Als wir uns gegründet haben, schien es fast unmöglich zu entscheiden, womit wir anfangen müssen oder wollen.
Für diejenigen unter uns, deren Aufenthaltsstatus unklar ist, ist das bloße “in Berlin sein” oft schon ein Kampf, zum Beispiel mit steigenden Mieten und begrenztem Wohnraum. Zugang zum Gesundheitssystem ist nur in akuten Notfällen möglich – ein weiterer Faktor, der den Alltag verkompliziert, mit der beständigen Sorge zu erkranken.
Der Arbeitsmarkt – Grundlage um über ein Einkommen den Alltag zu bestreitet – ist verschlossen und zwingt uns daher in prekäre und potentiell gefährliche Jobs. Bildung – der viel gepriesene Weg, um die eigene (ökonomische) Situation zu verbessern ist ein weiteres Feld, zu dem uns der Zugang praktisch unmöglich gemacht wird. Und über allem hängt die beständige Bedrohung der Abschiebung.
Der Zugang zur Stadt, zu städtischen Dienstleistungen ist voller Hindernisse. Ein Zustand der eine geteilte Stadt erschafft. Wenngleich wir so viele Grenzen überschritten haben, bleibt Berlin für jene von uns, die hier als Geflüchtete oder mit unsicherem Aufenthalt leben, eine Stadt voller Grenzen und Gräben, die unseren Alltag und auch unsere Träume begrenzen.
Was ist nun ein erster Schritt, raus aus diesem Netz aus Hindernissen und Einschränkungen? Diese Frage hat bei uns zu langen und intensiven Debatten geführt, und schließlich zu der Entscheidung, dass wir mit dem Zugang zum Gesundheitssystem beginnen müssen. Ausschlaggebend für diese Wahl waren die Stimmen der Menschen in unserer Gruppe, denen dieser Zugang teilweise oder vollständig verwehrt wird.
Wir sind keine Berufspolitiker_innen oder Technokrat_innen, aber wird sind jene, auf deren Schultern unser demokratisches System liegt. Wir wollen an Veränderungen und Verbesserungen des Systems arbeiten und nicht warten und hoffen, dass “jemand” sich schon kümmern wird.
Ausgehend von den Erfahrungen von Menschen in unserer Gruppe mit unsicherem Aufenthaltsstatus haben wir uns in unseren sozialen Netzwerken umgehört und mit unseren Nachbarn gesprochen. Wir haben gefragt, was Erfahrungen und Probleme mit dem Zugang zu gesundheitlicher Versorgung sind.
Anschließend haben wir uns die rechtlichen Grundlagen angeschaut, nach Lösungen in anderen Städten und Ländern gesucht und Lösungsvorschläge von anderen Initiativen auf ihre Übertragbarkeit gelesen. Auf Basis dieser Informationen haben wir anschließend unsere Forderungen für die Stadt Berlin entworfen, diese debattiert, sie verworfen, verbessert, modifiziert und wieder debattiert.
Am Ende diese Prozesses standen unsere erste Forderungen:
Wir fordern von der Stadt Berlin eine anonyme Gesundheitskarte. Diese Karte muss anonym sein, um die Sicherheit aller Menschen zu garantieren, die potentiell von Abschiebung bedroht sind.
Die Versorgung durch diese Karte muss der Regelversorgung entsprechen.
Wir sprechen uns explizit gegen Beschränkungen im Zugang zum Gesundheitssystem aus, unabhängig davon, wie diese Beschränkungen begründet werden. Das heißt unter anderem, dass die Versorgung physische und psychische Erkrankungen abdecken muss.
Die Gesundheitskarte soll bei der Ankunft in Berlin für alle zur Verfügung stehen, die sie benötigen. Das heißt für Menschen mit oder ohne Papiere, mit oder ohne deutscher oder europäischer Staatsbürgerschaft.
Medizinisch versierte Übersetzer_innen müssen zur Verfügung stehen, um einen wirklichen Zugang zum Gesundheitssystem zu gewährleisten.
Eine häufige Kritik unter den von uns Befragten war, dass die Versorgung lückenhaft oder unvollständig ist und den Eindruck von mangelndem Interesse hinterlassen habe. Neben der Sprache als möglicher Barriere verweist dieser Umstand auch auf strukturellen Rassismus innerhalb des Gesundheitssystems.
Wir fordern daher, dass medizinisches Personal auch rassismuskritisch geschult wird, sodass es einen einfühlsamen Umgang mit Patient_innen gibt, unabhängig von (vermuteter) Herkunft. Um einen derartigen Umgang zu gewährleisten, sollte auch ein Beschwerde-basiertes Kontrollsystem geschaffen werden.
Das sind unsere Forderungen. Allerdings bedeuten Lösungsvorschläge alleine nicht, dass diese von der Stadtregierung angenommen werden. Dafür müssen wir politischen Druck aufbauen…